Portfoliomanagement – was bedeutet der Begriff in der Informatik? Ein IT-Projektportfolio bündelt Vorhaben, die parallel laufen und sich entweder fachlich aufeinander beziehen oder sich Ressourcen teilen. Beim IT-Portfoliomanagement handelt es sich demnach um die zentrale Steuerung solcher Projekte.
Verteilen sich die Projekte eines strategischen IT-Programms auf mehrere Abteilungen, so führt dies insbesondere bei der Arbeit an analogen Anforderungen oft zu Überschneidung. Häufig hapert es auch an der Synchronisation der Laufzeiten beteiligter Systeme. Im Extremfall liefern Projektteams Leistungen ab, die einander neutralisieren. Mit einer zentralen Steuerung interdependenter Projekte schaffen Unternehmen die organisatorische Basis einer stabilen, leistungsstarken, am Geschäftsmodell ausgerichteten IT-Architektur.
Der Aufbau des IT-Portfoliomanagements beginnt mit einer gründlichen Analyse der Systemlandschaft. Daraus leiten wir eine Roadmap sinnvoller Projekte ab. Diese reichen von der Systempflege über den Umbau oder Austausch bis zur Abschaltung. Anhand der Roadmap lässt sich klären, welche Projekte zur Geschäfts- und IT-Strategie passen und was sie zum Ergebnis beitragen. Dabei orientieren sich die IT-Architekten und Portfoliomanager der Consileon und des Klienten an Enterprise-Architecture-Frameworks (EAF) wie Togaf oder zweckspezifischen Alternativen.
In der Projektarbeit setzen sich agile Vorgehensmodelle zunehmend durch. Damit kommen auf das Portfoliomanagement unter anderem die folgenden neue Aufgaben zu:
Megatrends wie Digitalisierung, Klimawandel oder die Erosion der Mittelschicht treffen auch die Automobilindustrie. Planten die Hersteller bisher langfristig im Modellzyklus, so konkurrieren sie heute mit den smarten Mobilitätsangeboten agiler neuer Mitspieler. In diesem Umfeld können sich die Anforderungen an ein Projekt jederzeit ändern. Das Portfoliomanagement bietet den Projektteams einen Rahmen, in dem sie schnell umdisponieren können. Mit dem Vormarsch der Vernetzung und Digitalisierung nimmt die Komplexität der IT-Architekturen unablässig zu. Auch in der Automobilindustrie ist der Wettbewerbsdruck mittlerweile so hoch, dass ein Umdenken eingesetzt hat. Schon seit einigen Jahren wenden immer mehr Unternehmen agile Methoden im großen wie im kleinen Maßstab an.
Consileon begleitet Klienten aus Branchen wie Automobil, Finanzindustrie und Einzelhandel beim Umstieg auf agiles Arbeiten sowie bei der Steuerung klassischer, agiler und hybrider Projektportfolios. Am besten gelingt dieser Wandel iterativ über mehrere Stufen.
Den Auftakt bildet eine Bestandsaufnahme. In Experteninterviews und Workshops verschaffen wir uns und dem Kunden einen Überblick über die laufenden Programme, klären deren Relevanz und Interdependenz und klopfen sie auf Überschneidung ab. Aus dieser Analyse ergeben sich Handlungsoptionen inklusive Konzepten zum Schließen etwaiger Lücken. Das Spektrum reicht hier von der Feinsteuerung über die Anpassung des Projektumfangs bis zu ergänzenden oder weiterführenden Projekten. Konzeptvorschläge werden getestet und iterativ abgestimmt. Die so gewonnenen Erkenntnisse geben wir in Präsentationen und Workshops an die Führungs- und Fachkräfte des Klienten weiter. Von mehreren Ressorts zu tragende Entscheidungen moderieren wir. Die Pflege des IT-Portfolios ist ein Dauerthema, das ständiger Aufmerksamkeit bedarf. Consileaner unterstützen Automobilunternehmen dabei fachlich, technisch und als externe Portfoliomanager.
Die Umsetzung der neuen Dimension Nachhaltigkeit in der Finanzindustrie ist in vollem Gange. Kunden kommunizieren, dass sie vermehrt in nachhaltig geprägte Produkte investieren möchten. Die Umstellung der Regulatorik auf europäischer und nationaler Ebene konkretisiert sich. Banken und Asset Manager müssen sich zukünftig auch in diesem Themenfeld positionieren. Doch wie soll das geschehen bei gleichzeitigem Margen- und Kostendruck sowie verschärftem Digitalisierungs- und Wettbewerbsdruck?
Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien und -risiken in den Prozessen von Banken und Asset Managern erfordert ein strukturiertes Vorgehen, das im Zentrum von einer klar definierten Nachhaltigkeitsstrategie ausgeht, welche in die aktuelle Geschäftsstrategie integriert werden sollte. Aufbauend auf dieser grundsätzlichen Positionierung werden fokussierte Produkt- und Vertriebsstrategien definiert. Deren Umsetzung betrifft end-to-end alle relevanten Bereiche, vom Vertriebs- und Beratungsprozess über den Produktentwicklungsprozess bis hin zu Kredit-, Organisations- oder Risikoprozessen.
Consileon hat bereits vor zwei Jahren ein Kompetenzteam gegründet, das sich intensiv mit den Fragestellungen zur Nachhaltigkeit im Finanzmarkt auseinandersetzt. Dieses steht Ihnen gerne für einen Austausch und zur Unterstützung bei Umsetzungsprojekten zur Verfügung.
Moderne Game Engines sind so universell einsetzbar, dass sie auch abseits von Computerspielen zum Einsatz kommen, um digitale Inhalte zu präsentieren. Dieses enorme Potential wird auch in der Automobilindustrie für die Visualisierung von Fahrzeugen genutzt.
Mit Game Engines rücken die bislang häufig konkurrierenden Ziele der ansprechenden Visualisierung, der Interaktionsmöglichkeit und der benötigten Hardwareleistung näher zusammen. Dadurch werden sie für Maschinenbauer und OEMs in allen Bereichen des Produktlebenszyklus interessant. Sei es zur Bewertung von Designentscheidungen in einer frühen Phase der Produktentwicklung ohne physikalische Abbilder der Konstruktionsdaten oder zur Veranschaulichung jeglicher Variation des Produkts in Richtung des Kunden.
Im Bereich der Virtual Reality (VR) können Game Engines ebenfalls eingesetzt werden. Virtual Reality ist eine höchst immersive Erfahrung, da diese Technologie den Nutzer in eine neue, virtuelle Welt bringt und dabei seine Umwelt komplett ausschließt. Somit können Fahrzeughersteller, die ihre Showroom-Konfiguratoren auf eine Game Engine umstellen, ihre Kunden individuell konfigurierte Traumautos direkt mittels VR erleben lassen. Fahrzeuge können vor Produktionsstart dadurch nicht nur erkundet, sondern zukünftig auch virtuell Probe gefahren werden. Haptisch sitzt man dabei zwar in einer echten Karosserie, jedoch wird die wahrgenommene optische Umwelt durch digitale Medien „gezeichnet“. Zusätzlich kann der Kunde währenddessen kinderleicht die Konfiguration verändern, denn nur wenn der Kunde alle Möglichkeiten kennt und ausprobiert hat, kann er sich richtig entscheiden.
Grundlage eines jeden erfolgreichen Spiels ist seine Game Engine, wie zum Beispiel Unity oder die Unreal Engine, da sie entscheidend ist für die Benutzerfreundlichkeit des Spiels und somit für die Zufriedenheit der Spieler. Eine aktuelle Game Engine bietet alle nötigen Werkzeuge, um eine interaktive Erfahrung in beliebiger Ausprägung frei zu gestalten. Die Game Engine hinter dem jeweiligen Spiel kann genutzt werden, um das interaktive Verhalten, also die Reaktion auf Spielereingaben, zu programmieren, 3D-Modelle im Raum zu platzieren, Objekte zu texturieren, Animationen abzuspielen, Audiosignale wiederzugeben, Physikeffekte zu berechnen und Mehrspielerverbindungen aufzubauen. Die hohe Vielfalt verfügbarer Game Engines in einem Massenmarkt und eine permanente Steigerung der Hardwareleistung sorgen dabei seit Jahren für eine kontinuierliche Weiterentwicklung, Verbreitung und Öffnung, was der weltweite Umsatz der Videospielbranche von 73 Milliarden Euro im Jahr 2019 [https://de.statista.com/outlook/203/100/videospiele/weltweit] nur unterstreicht. Wurde früher oft für jedes Spiel erst die eigens dafür konzipierte Game Engine entwickelt, dominieren heute weit verbreitete und bis zu einem gewissen Grad sogar kostenlos einsetzbare Alleskönner; diese werden immer stärker auch in Branchen jenseits von Videospielen eingesetzt, wo ihr Potential erfolgsbringend ausgeschöpft wird.
Consileon bietet ganzheitliche Beratung zum strategischen und prozessualen Einsatz von Game Engines in Ihrem Unternehmen an. Neben konzeptioneller Unterstützung beraten wir unter Berücksichtigung aller Vor- und Nachteile sowie technologischer Grenzen bei der Auswahl der für Sie optimalen Game Engine. Zusätzlich unterstützen wir Sie auch bei der Entscheidung, ob der Einsatz einer Game Engine in einem speziellen Use Case sinnvoll und ökonomisch ist oder ob der gewünschte Effekt stattdessen auch durch bestehende Softwareprodukte in Kombination mit höherwertiger Hardware erzielt werden kann.
Mittelfristig wird jeder Finanzdienstleister nachhaltige Anlagestrategien anbieten. Abheben können sich Wealth Manager beim Kunden mit individualisierter Nachhaltigkeit.
Es gibt kaum einen Bereich des täglichen Lebens, in dem Nachhaltigkeit kein Thema ist. Ausgehend von einem Umdenken der Konsumenten im Bereich der Lebensmitteleinkäufe, versuchen nun fast alle Unternehmen auf die Nachhaltigkeit ihrer Produkte und Dienstleistungen aufmerksam zu machen. Lässt sich dieses Phänomen auch auf die Finanzbranche übertragen? Und was bedeutet dies für Wealth Manager? Welche Möglichkeiten eröffnen sich durch den potentiellen Wandel?
Die Antwort darauf gibt Ihnen Sabine Beinhardt.
Den gesamten Artikel können Sie hier nachlesen (letzter Abruf der Seite 18.05.2020)
Die zunehmende Digitalisierung über alle Branchen hinweg eröffnet neue Vertriebs- und Marketingchancen. Soziale Medien wie Facebook, Instagram oder Snapchat erfuhren in den letzten Jahren atemberaubende Wachstumsraten. Aktuell erleben wir dies in ähnlicher Form bei dem Videoportal TikTok. Während Werbung aber immer genauer und differenzierter die entsprechende Zielgruppe anspricht, so hängen manche Branchen den Erwartungen ihrer Kunden bezüglich der Vertriebswege hinterher.
Neben „klassischem“ Online-Marketing, zum Beispiel über E-Mail-Kampagnen, lassen sich über soziale Medien kostengünstig und schnell aktuelle Kampagnen, zugeschnitten auf die Zielgruppe, aufsetzen. Der Erfolg dieser Kampagnen lässt sich mit technischen Möglichkeiten im Rahmen von Campaign-Tracking leicht messen. Integriert ein Unternehmen das Online-Marketing in seine Touchpoints und Bestellsysteme, kann der Vertriebserfolg einzelner Kampagnen an echten Verkäufen gemessen und mittels geeigneter Kennzahlen (KPIs) analysiert werden. Zukünftige Kampagnen lassen sich daraufhin auf Basis der Ergebnisse optimieren. Ebenso können jene Berührungspunkte ausgemacht werden, an denen Interessierte abspringen und nicht zu Kunden werden.
Regulatorische Vorhaben wie beispielsweise die anstehende Umsetzung der europäischen MiFID II Richtlinie führen zu Umbrüchen im Markt und verlangen sowohl von External Asset Managern (EAM) als auch von ihren Depotbanken ein Umdenken. Preiserhöhungen, Eigentümerwechsel und IT-Umstellungen belasten das Verhältnis zwischen External Asset Managern und ihren Depotbanken zusätzlich. In diesem Umfeld buhlen Regionalbanken, Direktbanken, traditionsreiche Privatbanken, nationale und internationale Großbanken sowie spezialisierte Fondsdepotbanken um Mandate und nehmen dabei eine besondere Rolle im Dreieckskonstrukt von EAM, Depotbank und Endkunden ein. Doch wie zufrieden sind External Asset Manager mit ihren Depotbanken und wo sehen sie Schwachstellen? Welche Leistungen sind es, mit denen sich eine Depotbank vom Wettbewerb abheben kann?
Die an unserer Umfrage teilnehmenden EAM sind mit ihren Depotbanken grundsätzlich zufrieden. Dennoch gibt es einiges Potential zur Verbesserung. In der Kritik stehen besonders
Darüber hinaus wird die Reputation einiger Depotbanken als kritisch angesehen – sicher kein Punkt, der sich kurzfristig beheben lässt. Neben der Verbesserung in den genannten Punkten bieten sich den Depotbanken durch Angebote von Zusatzleistungen gute Möglichkeiten, neue EAM als Kunden zu gewinnen bzw. die Bindung zu ihrem Kundenstamm zu stärken.
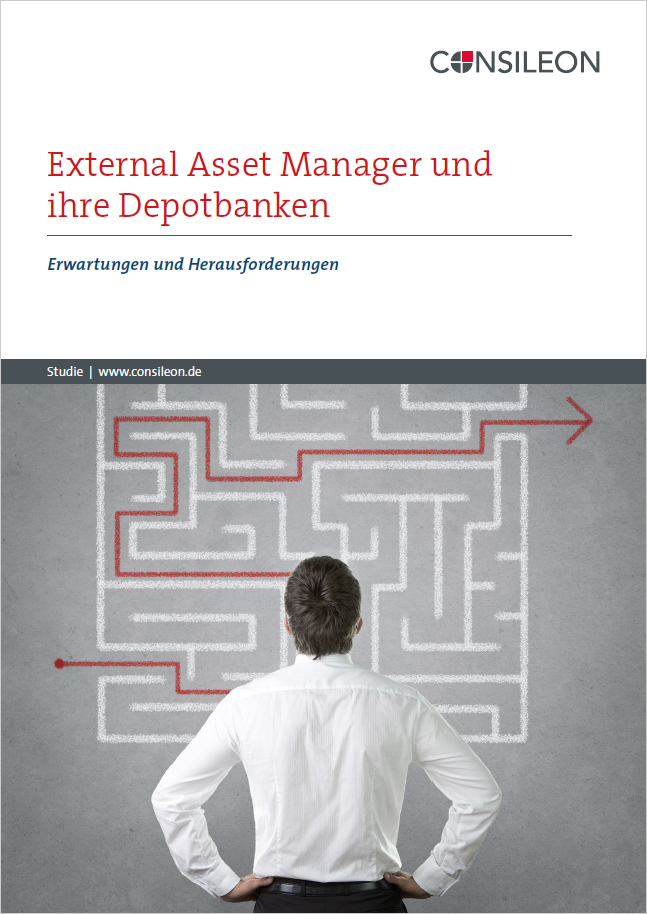
Erfahren Sie mehr in unserer Studie External Asset Manager und ihre Depotbanken.
Schon beim Überfliegen der Tages- und Fachpresse legt sich Entscheidern im Retailbanking die Stirn in Sorgenfalten: Während erodierende Zinsspannen, die Schnäppchenjagd mancher Kunden, Kaufzurückhaltung bei Wertpapieren sowie aggressive digitale Finanzdienste (Fintechs) an den Erträgen nagen, steigen durch Investitionen in Multikanalangebote, regulatorische Vorgaben und höhere Löhne die Kosten.
Da dürfte der eine oder andere Retailbanker neidisch auf die Kollegen im Wealth Management (WM) oder Private Banking blicken. Dort sieht es so aus, als sei die Welt noch in Ordnung. Statt Zinshoppern mit Vorliebe für kostspielige digitale Interaktionskanäle dominiert eine am Preis wenig interessierte Kundschaft, die sich gerne auf Berater und Mandate einlässt. Auch die Zukunft scheint rosig: Man setzt auf Bewährtes wie den persönlichen Ansprechpartner, optimiert durch Einsatz moderner CRM-Systeme die Betreuungsrelationen, bemüht sich um eine gute Wertentwicklung und investiert in die technische Ausstattung nur das Nötigste. Schließlich punktet man in erster Linie mit dem guten Draht zum Kunden.
Als Consultants mit langjähriger Erfahrung in der Finanzindustrie hat uns dieses zwar vereinfachte, im Kern aber zutreffende Selbstbild der Privatbanker nie überzeugt. Deshalb reisen wir mit der vorliegenden Untersuchung in die Zukunft des Wealth Managements. Dazu haben wir dreißig wohlhabende Anleger im Alter unter dreißig Jahren jeweils im explorativen Einzelgespräch zu ihren Erwartungen an ihren Vermögensverwalter befragt.
Das Ergebnis legt nahe, dass im Private Banking ebenso tief greifende Veränderungen anstehen wie im Massengeschäft. Gleichwohl hat sich das Gros der Vermögensverwalter offenbar mit dem Modernisierungsstau in ihrem Metier arrangiert. Auch wenn der eine oder andere Branchenführer seine Absatzwege ausbaut, vernetzt und Onlinedienste anbietet, scheinen die meisten Mitspieler zu hoffen, Neukunden ließen den Wunsch nach E-Banking und Kanalintegration an der Schwelle zum Wealth Management fallen (oder forderten derlei nur im Giroverkehr) und hörten fortan nur noch auf den ihnen zugewiesenen Berater.
Unsere Studie zeigt indes: Manche jüngere Vermögende kommen nie richtig im Wealth Management an. In den meisten wohlhabenden Familien bestehen Beziehungen zu WM-Anbietern, doch oft fehlt der jungen Generation ein Motiv, sich ihrer zu bedienen. Mangels eines Betreuungsmodells für die Reichen von morgen finden die Anbieter keinen Zugang zu ihnen und verlieren dadurch gegenüber den omnipräsenten Retailbanken und expandierenden Fintechs an Boden. Dies ist nicht zuletzt deshalb kritisch, weil die jungen Anleger über Finanzmittel verfügen, die sie schon in jungen Jahren als Kunden interessant machen.
Nimmt ein junger Investor dennoch Kontakt zu einem Wealth Manager auf, werden seine Erwartungen in vielen Fällen enttäuscht. Dabei wünscht sich die Zielgruppe kein futuristisches Brimborium, sondern nur die konsequente Weiterentwicklung klassischer WM-Tugenden. Junge Vermögende möchten ebenso persönlich betreut werden wie die Generationen vor ihnen. Nur eben auch über Kanäle wie E-Mail und Websites. Zudem erwarten die mit dem Internet aufgewachsenen Vermögensnachfolger ständige Erreichbarkeit und maßgeschneiderte Angebote.
Laut den Teilnehmern unserer Umfrage gelingt es Wealth Managern nur selten, diesen Ansprüchen zu genügen. Konsequenz: Knapp die Hälfte unseres Panels gibt an, sie werde sich nach etwaigen weiteren Vermögenszuflüssen nach einem anderen Vermögensverwalter umschauen.
Aus Anbietersicht stellt sich somit die Frage, wie die im Wealth Management nach wie vor essenzielle persönliche Beratung auf den digitalen Kanälen zu leisten ist. Wer hier unter den ersten rangiert, die überzeugende Lösungen präsentieren, verschafft sich einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil. Dabei können die Antworten beispielsweise mit der Marktposition des Unternehmens divergieren. Gehören bei großen WM-Anbietern Onlinefunktionen künftig zum Standard, so erreichen kleinere Häuser im ersten Anlauf schon viel, wenn sie telefonisch länger erreichbar sind und mehr per E-Mail kommunizieren. Auch wenn unsere Studie die Ansichten junger Vermögender dokumentiert, dürften solche Maßnahmen bei allen Kundengruppen fruchten.
Um den Erfolg bei jüngeren Kunden zu maximieren, sollten Wealth Manager für diese ein eigenes Betreuungsmodell entwickeln. Am Generationenwechsel orientierte Ansätze springen mit ihrem Fokus auf die Erbschaft zu kurz. In der Praxis geht es eher darum, Vertreter der Zielgruppe – auch im Kundenstamm – zu erkennen, mit exklusiven Angeboten wie den sogenannten Conciergediensten anzusprechen und den Dialog über die Kanäle ihrer Wahl in Gang zu halten.
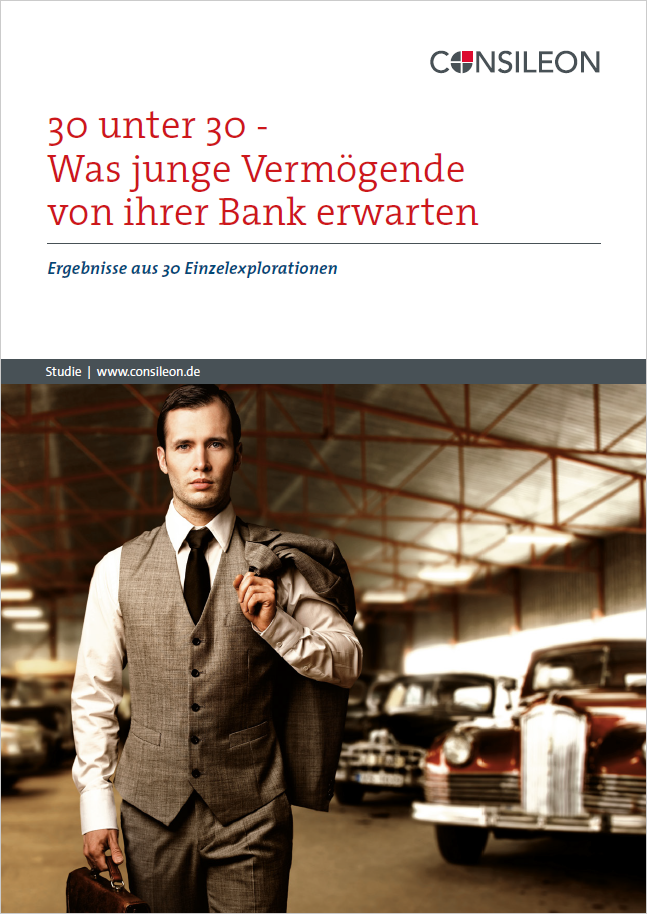
Erfahren Sie mehr in unserer Studie 30 unter 30 – Was junge Vermögende von ihrer Bank erwarten.
Unter virtueller Realität (virtual reality, VR) versteht man per Computer generierte und animierte, realitätsnahe Bildwelten, die sich dem Blickwinkel des Betrachters in Echtzeit anpassen. Im Marketing eingesetzt, machen sie ein Produkt emotional erlebbar, noch bevor es vom Band rollt. Speziell im Vertrieb kostenintensiver, personalisierbarer Produkte sind VR-Modelle sinnvoll, etwa in der Automobilindustrie, die Neuwagenkäufern eine individuelle Konfiguration anbietet. So lässt sich ein und dasselbe Modell prinzipiell in mehreren Millionen Varianten bestellen. Um eine virtuelle Realität zu erschaffen, braucht man nicht nur Software, die dreidimensionale Bilder aus beliebiger Perspektive in Echtzeit berechnet, sondern auch eine Wiedergabe-Hardware, deren Bildfrequenz (frames per second, FPS) hoch genug ist, um einen Eindruck fließender Bewegung zu erzeugen. Eine zu niedrige Bildfrequenz kann beim Betrachter Übelkeit auslösen. Da die nötige Technik mittlerweile marktreif und erschwinglich ist, nehmen VR-Modelle sowohl im B2C- als auch im B2B-Marketing einen immer höheren Stellenwert ein.
Aus der rechnergestützten Konstruktion (computer-aided design, CAD) verfügen Hersteller technischer Güter wie die Automobilbauer über umfangreiche 3D-Daten. Diese lassen sich mit moderatem Aufwand zur bildlichen Darstellung beispielsweise eines Fahrzeugs auf der Markenwebsite, im Konfigurator oder Katalog aufbereiten. Dazu müssen die Maße aus den CAD-Systemen unter anderem mit Materialien belegt werden. Zudem gilt es, die einzelnen Teile so miteinander zu verschalten, dass die Anordnung aus jedem Blickwinkel stimmt. Diese keineswegs trivialen Arbeiten erfordern ständige Kontrolle und Anpassung, zumal sich selbst kleine, kurzfristige Änderungen am Datenbestand, etwa anlässlich der jährlichen Modellpflege, massiv auf die Visualisierung auswirken können.
Virtuelle Vorführwagen kämen vor allem dem Handel zugute. Die zunehmende Modellvielfalt und -komplexität überfordert die Händler zuweilen. Hatte ein Hersteller früher fünf bis zehn Modelle im Programm, so kommen manche heute auf über vierzig. Wie viele Autohäuser verfügen über die Fläche, eine so große Zahl jeweils in mehreren Varianten vorzuhalten? Viele der neuen Funktionen und Extras sind zudem erklärungsbedürftig. Hier erwarten die Händler von den Herstellern attraktive Medien zur Unterstützung des Verkaufsgesprächs. Die Produktion hochglänzender Broschüren oder Kataloge ist jedoch kostspielig und zeitintensiv. Obendrein veralten sie schnell. Zitat aus der Praxis: „Um moderne Technik zu erklären, brauche ich moderne Technik.“ Zum Beispiel einen VR-Konfigurator, der Folgendes bietet.
Auch auf das Design der VR-Umgebung und ihre Präsentation im Autohaus kommt es an. Wenn sich der Kunde ein Premiumprodukt leistet, sollte bereits der Schauraum Wertigkeit und Modernität ausstrahlen. Ein VR-Konfigurator erfüllt diesen Anspruch. Zur kundenorientierten Entwicklung der Software empfehlen wir eine agile Methodik, die eine schnelle Anpassung an Modifikationen im Anwendungsfall erlaubt. So kann Feedback etwa aus dem Handel kurzfristig in die Lösung einfließen.
Ist ein internationaler Einsatz der Software geplant, so sind Länderversionen zu programmieren, die die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften abbilden. Eine weitere anspruchsvolle Aufgabe besteht darin, den Konfigurator in die Fläche, das heißt zu den Händlern, auszurollen und den Support sowohl der Hard- wie der Software in allen Einsatzländern zu organisieren. Zwischen dem Autohersteller, VR-Anbietern und Autohäusern sind dabei zahlreiche Fragen zu klären, von der Beschaffung der Hardware einschließlich Möbeln über Nutzungsverträge bis zur Einrichtung der drei Supportebenen.
Interessiert Sie der Einsatz der virtuellen Realität als Vertriebstool? Dann sprechen Sie uns an! Wir beraten Sie unter anderem zu folgenden Aspekten:
Umfangreiche Informationen finden Sie in unserem Content Magazin Ausgabe 2.
Die Digitalisierung, immer neue Kundenwünsche und ein verändertes Marktumfeld verlangen von Produkt- und IT-Entwicklern maximale Flexibilität bei hohem Tempo. Lösung – das gesamte Unternehmen muss agil werden. Dies betrifft den Mittelstand ebenso wie transnationale Konzerne, auch wenn sich die Umstellung auf agiles Arbeiten in kleineren Betrieben einfacher gestaltet. Allerdings stehen speziell bei Herstellern anspruchsvoller Produkte eingespielte, mit der Aufbauorganisation verzahnte Prozesse, einer Agilisierung entgegen.
Merkmale eines von Agilität geprägten Unternehmens sind die erfolgreiche Einbindung junger und neuer Kollegen sowie eine offene Kommunikation über Hierarchiestufen hinweg, die Kreativität fördert und Probleme ans Licht bringt, bevor sie eskalieren. Agile Mitarbeiter fassen Veränderung nicht als Bedrohung auf, sondern als Normalfall und Chance.
Ein agiles Unternehmen zu werden, ist eine Grundsatzentscheidung. Es reicht nicht, wenn einzelne Teams die Pionierarbeit leisten. Allen voran müssen sich die Führungskräfte auf den anstehenden Kulturwandel einlassen und ihn vorleben. Zudem gilt es, ein Vorgehensmodell zu wählen, das zu den eigenen Unternehmenswerten, Projekten, Mitarbeitern und Strukturen passt. Setzen beispielsweise Kanban oder Scrum eher auf der Ebene der Teams und deren Leitung an, so lassen sich etwa mit PULSE auch das mittlere und das obere Management agilisieren
Die Automobilindustrie steht mitten im Umbruch. Neue Wettbewerberagieren teils als Partner, teils als Konkurrenten, der Zuliefermarkt konzentriert sich, die Nachfrage geht zurück. Um sich in diesem Umfeld zu behaupten, müssen die Hersteller agiler werden. Wir als Consileon begleiten den Umstieg auf agile Methoden nicht nur in der Softwareentwicklung, sondern auch in Kernressorts wie Einkauf, Produktion, Vertrieb, Controlling oder Personalwesen.
Über fünf Stufen machen unsere Experten auch Ihr Unternehmen agiler:
Dieser Kulturwandel gelingt nur, wenn die Belegschaft ihn mitträgt. Deshalb beziehen wir Ihre Mitarbeiter von Anfang an ein. Besonders interessierte Mitarbeiter können den Coaches als Tandempartner assistieren, um ihre Kollegen später selbst zu coachen oder als Scrum Master zu wirken und die Agilisierung über das Projekt hinaus voranzutreiben.
Nachhaltigkeit ist das „new normal“ in der Anlage. Dies stellt Anbieter, die sich bislang über nachhaltige Anlagestrategien differenzieren konnten, vor die Herausforderung, ihren Wettbewerbsvorsprung zu halten. Gleichzeitig überlegen Anbieter ohne besonderes Nachhaltigkeitsprofil, wie sie zum Wettbewerb aufschließen können.
Unser Kunde verfolgt das Ziel, Nachhaltigkeit als Kern seiner Beratungsproposition zu platzieren. Er bat uns darum, dieses Ziel so in den Beratungsprozess zu verankern, dass Berater bei der Ansprache des Themas beim Kunden unterstützt werden und diese Nachhaltigkeit unmittelbar und individuell erleben.
Im Ergebnis konnte das strategische Ziel der Nachhaltigkeit für Mitarbeiter und Kunden erlebbar gemacht werden – dies trug zu einem signifikanten Wachstum der nachhaltig investierten Assets bei.