Karlsruhe, 8. Dezember 2025. Die demografische Entwicklung verschärft den Arbeitskräftemangel und damit das Risiko, dass wertvolles Erfahrungswissen im Unternehmen verloren geht. Das aktuelle Whitepaper der Consileon-Gruppe mit dem Titel „Wissen sichern, Lücken schließen – mit generativer KI gegen den demografischen Wandel“ zeigt, wie Unternehmen Wissen systematisch erfassen, intelligent nutzbar machen und im Alltag kontextbezogen bereitstellen können.
In den nächsten 15 Jahren werden laut Statistischem Bundesamt rund 13,4 Millionen Erwerbspersonen das gesetzliche Renteneintrittsalter erreichen: Das entspricht knapp einem Drittel der Menschen, die dem Arbeitsmarkt im Jahr 2024 zur Verfügung standen. Diesen Fachkräftemangel können jüngere Altersgruppen selbst bei hoher Nettozuwanderung nicht auffangen – bei niedriger Zuwanderung könnte sich die erwerbstätige Bevölkerung um bis zu 4,8 Millionen reduzieren. „Unternehmen verlieren damit nicht nur erfahrene Arbeitskräfte, sondern auch, was viel schwerer wiegt, in Jahrzehnten aufgebautes Wissen. Ein zusätzliches Problem: Wissen steckt meist in Köpfen, nicht in Datenbanken. Deshalb benötigen Firmen ganz konkrete Lösungen, mit denen sich dieser Erfahrungsschatz für die Zukunft erhalten lässt“, sagt Dr. Joachim Schü, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Consileon-Gruppe.
Zu diesem Zweck bündelt die Consileon-Gruppe in ihrem Whitepaper umfangreiche Erfahrung aus Kundenprojekten und die Expertise ihres KI-Teams mit Best Practices international führender Unternehmen. Darauf aufbauend zeigt Consileon praxisnah, wie Unternehmen generative KI nutzen können, um
„Wer heute in den strategischen Einsatz von KI investiert, stärkt die Innovationskraft, sichert Wettbewerbsvorteile und erhöht die Resilienz in Zeiten des demografischen Wandels“, fasst Dr. Joachim Schü zusammen. „Consileon unterstützt Organisationen mit einem ganzheitlichen Ansatz dabei, eine individuelle KI- und Wissensstrategie zu entwickeln und erfolgreich zu implementieren, um zentrale Herausforderungen von morgen mit Technikkompetenz zu lösen.“
Der Fachkräftemangel ist längst Realität. Immer mehr erfahrene Teammitglieder gehen in den Ruhestand; mit ihnen verschwinden wertvolles Wissen und langjährige Praxiserfahrung. Gleichzeitig verschärft der weltweite Wettbewerb um Talente den Druck auf Unternehmen.
Generative KI eröffnet in dieser Situation neue Möglichkeiten. Sie hilft, Wissen zu bewahren, Prozesse zu automatisieren und Mitarbeiter gezielt zu entlasten. Entscheidend ist jedoch, wie Unternehmen diese Technologie strategisch nutzen und dabei den Menschen in den Mittelpunkt stellen.

In unserem Whitepaper „Strategien gegen den Fachkräftemangel – Wissen sichern, Lücken schließen – mit generativer KI gegen den demografischen Wandel“ erfahren Sie, wie Organisationen den Verlust von Know-how verhindern können, welche Rolle intelligente Assistenzsysteme und KI-Agenten in der Praxis spielen und weshalb ethische Grundsätze, eine klare Kultur sowie entschlossene Führung unabdingbar für einen erfolgreichen Einsatz sind.
Das Whitepaper gibt praxisnahe Einblicke aus heute schon gelebter Realität, vermittelt konkrete Anwendungsbeispiele und zeigt, wie Unternehmen Schritt für Schritt eine nachhaltige KI-Strategie entwickeln können.
Bestellen Sie hier das kostenfreie Whitepaper zur richtigen (KI-)Strategie gegen den Fachkräftemangel.
In der August-Ausgabe der Fachzeitschrift Pharma Relations steht die Frage im Fokus, wie Unternehmen im Gesundheitswesen dem digitalen Wandel nicht nur begegnen, sondern ihn aktiv gestalten können. In einem Interview sprechen Vertreterinnen und Vertreter der Consileon-Gruppe über zentrale Erfolgsfaktoren der digitalen Healthcare-Transformation – mit besonderem Augenmerk auf Change Management, digitale Innovation und regulatorische Anforderungen.
Im Gespräch geben Susanne Jurasovic, Partnerin bei Consileon DX (ehemals Geschäftsführerin der Lüdke + Döbele GmbH), sowie Dr. Peter Göbel, Associate Partner bei Consileon und Healthcare-Spezialist, Einblicke in die Herausforderungen ihrer Kunden und wie sie diesen mit einem integrierten, menschenzentrierten Ansatz begegnen. In gemeinsamen Healthcare-Projekten bündeln sie ihre Erfahrungen, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.
Im Interview betonen beide, dass erfolgreiche Transformation kein rein technisches Projekt ist. Vielmehr braucht es eine ganzheitliche Strategie, die digitale Lösungen mit der richtigen Kommunikationskultur und einer konsequenten Change-Begleitung verbindet. Gerade im komplexen Umfeld des Gesundheitswesens mit seinen sensiblen Daten und regulatorischen Anforderungen ist das entscheidend.
„Veränderung gelingt nur, wenn die Mitarbeitenden den Sinn dahinter erkennen – keine Schulung führt zum Erfolg, wenn das Mindset nicht stimmt“, betont Susanne Jurasovic. Diese Haltung prägt den Ansatz der Consileon DX, bei dem der Mensch stets im Zentrum digitaler Innovation steht.
Auch Dr. Peter Göbel macht deutlich: „Die Digitalisierung ist das größte Gestaltungsmittel im Gesundheitswesen. Doch technische Lösungen müssen im Umgang mit sensiblen Daten vor allem sicher und compliant arbeiten.“ Consileon kennt die spezifischen Herausforderungen des Gesundheitswesens und begleitet Akteure der Branche mit fundierter Regulatorik-Expertise und IT-Kompetenz.
>>> Ganzes Interview online lesen
Das Consileon Regulatorik-Radar unterstützt Unternehmen im Gesundheitswesen bei der Einhaltung und Umsetzung regulatorischer Anforderungen. Ein Anwendungsbeispiel ist die Einhaltung der Qualität, Integrität und Rückverfolgbarkeit von Arzneimitteln entlang der gesamten Lieferkette bei Pharmaunternehmen; die Einhaltung der Good Distribution Practice (GDP) Guidelines. Dabei übernimmt die KI die automatisierte Überprüfung von Dokumenten, Prozessen und Lieferketten auf GDP-Konformität, unabhängig von Sprache oder Format. Dank erprobter Branchenexpertise, kombiniert mit moderner KI-Qualitätssicherung, ermöglicht die Lösung effiziente, transparente Audits mit einem klaren „Ampel“-System für den Compliance-Status und reduziertem Aufwand für Auditoren.
Pharma Relations ist das führende deutschsprachige Magazin für Pharma-Marketing und Healthcare-Kommunikation. Monatlich informiert Pharma Relations die Top-Entscheider über Medien und Märkte, berichtet über Politik und Personalien, präsentiert Trends und Tendenzen.
In einem Interview mit den Salzburger Nachrichten schildert Harald Kohlberger, geschäftsführender Gesellschafter der Consileon Österreich, seine Beobachtungen zur aktuellen Entwicklung von Digitalisierungsprojekten in der öffentlichen Verwaltung. Seinen Aussagen zufolge würden derzeit nur wenige neue Vorhaben angestoßen, während bestehende Projekte teilweise pausiert oder gestoppt würden.
Kohlberger weist in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung digitaler Technologien und insbesondere von Künstlicher Intelligenz (KI) für eine moderne, effiziente Verwaltung hin. Aus seiner Sicht sei es wichtig, den eingeschlagenen Weg der Digitalisierung konsequent weiterzugehen, um langfristig Effizienzpotenziale zu nutzen und die öffentliche Hand zu entlasten.

Die Consileon-Gruppe konnte in den letzten Jahren gemeinsam mit Partnerunternehmen eine umfangreiche öffentliche Ausschreibung im Volumen von rund 700 Millionen Euro für Digitalisierungsprojekte in Österreich für sich entscheiden. In diesen Projekten kommt unter anderem auch die KI-Expertise von Consileon zum Einsatz: Unsere Lösungen reichen von intelligenten Prozessautomatisierungen über datengetriebene Entscheidungsunterstützung bis hin zu maßgeschneiderten KI-Architekturen für die öffentliche Verwaltung.
Der vollständige Artikel ist am 23. Juli 2025 in der Print- und Online-Ausgabe der Salzburger Nachrichten erschienen.
Demografischer Wandel und strukturelle Marktveränderungen treffen auf eine zunehmend digitale Kundenerwartung. Die Zahl der aktiven Vermittler sinkt kontinuierlich, Nachfolgeregelungen bleiben oft aus, während Konsolidierung, Plattformökonomie und technologiegetriebene Anbieter das Spielfeld neu ordnen.
Hinzu kommen steigende Anforderungen auf Kundenseite. Versicherte erwarten schnelle, transparente und personalisierte Kommunikation – kanalübergreifend und jederzeit erreichbar. Klassische Vertriebsmodelle geraten dadurch an ihre Grenzen. Sie stoßen an Kapazitätsgrenzen, lassen sich schwer skalieren und bieten nur begrenzte Flexibilität in der Kundenansprache.
Technologische Entwicklungen eröffnen neue Handlungsspielräume. Hybride Betreuungsmodelle, digitale Selfservices und automatisierte Kommunikationsprozesse schaffen Potenziale für eine moderne und resilientere Architektur des Versicherungsvertriebs. Doch der Weg dorthin erfordert strategische Weichenstellungen, von der Kunden- und Vermittlersegmentierung über neue Rollenverteilungen bis zu Investitionen in IT und Dateninfrastruktur.
Wie können Versicherer den Zugang zum Kunden auch in Zukunft sichern? Welche Rolle spielen hybride Betreuungsmodelle, digitale Services und moderne IT-Strukturen dabei? Und wie lässt sich die Zusammenarbeit mit Vermittlern zukunftsfähig gestalten?

Im aktuellen Themendossier „Vertrieb der Zukunft“ der Versicherungsforen Leipzig analysieren Dr. Michael Reich und Martin Ehret, welche Herausforderungen und Chancen sich für Versicherer daraus ergeben und warum es jetzt eine klare strategische Antwort auf die strukturelle Erosion der Vertriebskapazität braucht.
In den vergangenen Jahren lag der Fokus bei dem Thema Nachhaltigkeit oftmals auf der Bekämpfung des Klimawandels. Dabei hat sich abseits der öffentlichen Aufmerksamkeit eine viel größere Bedrohung für die Grundlage von Wirtschaft und Gesellschaft entwickelt: der Verlust von Biodiversität in allen Ökosystemen der Welt.
Zur Einordnung: Bereits 2020 hatte das World Economic Forum in einem Bericht1 darauf hingewiesen, dass mehr als die Hälfte des globalen BIP von der Natur und von Naturdienstleistungen abhängt und die Menschheit damit einem nicht zu unterschätzenden Risiko durch Biodiversitätsverlust ausgesetzt ist.
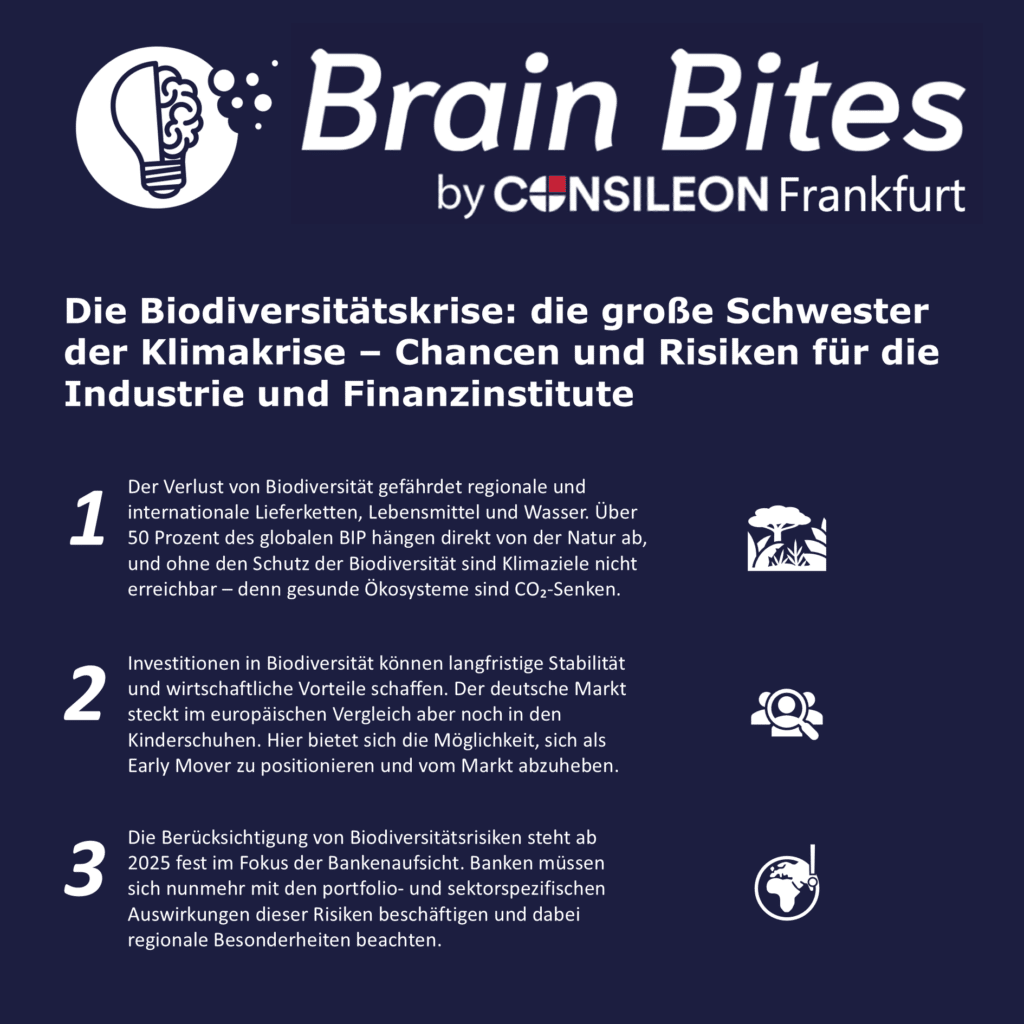
Im Jahr 2022 war auf der 15. Weltnaturkonferenz (CBD COP 15) mit dem „Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework“ ein erster Meilenstein zum Schutz der Biodiversität beschlossen worden, in dem vier langfristige und 23 mittelfristige Ziele formuliert sind. Das Wichtigste unter ihnen: Bis 2030 sollen mindestens 30 Prozent der weltweiten Land- und Meeresflächen unter Schutz gestellt werden. Ferner sollten bis 2025 jährlich 20 Milliarden US-Dollar aus Ländern des Globalen Nordens in den Globalen Süden fließen. Auch die Finanzindustrie wird explizit genannt, mit dem Ziel, die negativen Auswirkungen von Wirtschaft und Finanzwesen auf die Biodiversität zu verringern und die positiven Einflüsse zu steigern.
Entsprechend hoch waren die Erwartungen an die 16. Weltnaturkonferenz, die vom 21. Oktober bis zum 1. November 2024 in Kolumbien stattfand. Ziel war es, eine Strategie zu entwickeln, wie Natur- und Umweltschutz finanziert werden kann. In dieser zentralen Frage konnte jedoch keine Einigung erlangt werden. Trotzdem können und müssen Banken wie auch Finanzdienstleister bereits jetzt ihren Beitrag leisten, um den weltweiten Biodiversitätsverlust aufzuhalten.
Der erste Schritt dabei ist die Integration der Biodiversitätsrisiken und -chancen in die Strategien und das Risikomanagement. Eine hohe Portfolio-Allokation in Branchen, die durch eine besonders starke Abhängigkeit von Naturkapital geprägt sind – etwa die Baubranche, die Agrarindustrie oder die Lebensmittelindustrie – kann langfristige Folgen für die Risikotragfähigkeit haben. Die frühzeitige Berücksichtigung dieser Risiken wie auch deren Management durch konkrete Maßnahmen sind daher sinnvoll und können sogar zur Erschließung neuer Geschäftsfelder führen. Mögliche Maßnahmen sind eine Transformationsbegleitung von Kunden oder das Angebot von naturpositiven Produkten und Dienstleistungen. Die BBVA hat beispielsweise in 2024 die erste Biodiversitätsanleihe ausgegeben.
Wichtig ist dabei, dass die Berücksichtigung der wesentlichen Biodiversitätsrisiken bereits eine Anforderung der Bankenaufsicht ist, die ab 2025 auch in den Prüfungsfokus rückt. Doch im europäischen Vergleich hinken deutsche Banken hinterher, während niederländische oder französische Kreditinstitute Biodiversitätsrisiken bereits flächendeckend in ihre Strategien und die Risikomanagementprozesse integriert haben. Beispielsweise hat die ABN AMRO einen Biodiversitäts-Aktionsplan entwickelt, der die Integration von Biodiversitätsaspekten in das Risikomanagement und die Bewertung von Geschäftskunden vorsieht. Ziel ist es, die negativen Auswirkungen auf die Biodiversität zu reduzieren und den positiven Einfluss zu maximieren.
Ein zentrales Problem ist, dass Biodiversitätsrisiken und -chancen selbst bei Kreditinstituten mit ähnlicher Größe und Kundenstruktur (beispielsweise im Fall mittelständischer Unternehmen) stark variieren können. Der Grund dafür sind regionale Unterschiede (Kunden in Küstenregionen gegenüber jenen in den Alpen) oder sektorspezifische Unterschiede (Baubranche versus Landwirtschaft). Dadurch variieren auch die Key Risk Indicators, um die Risiken messbar zu machen, stark. Forscherinnen und Forscher der Universität Stockholm haben am Beispiel der Bergbauindustrie illustriert, dass ähnliche Aktivitäten sehr unterschiedliche Auswirkungen auf das Erdsystem haben können, abhängig vom Standort2. Dafür nutzten sie den Earth System Impact Score (ESI) und verdeutlichten so die Notwendigkeit von sektorspezifischen und standortbezogenen Risikoindikatoren.
Was können Finanzinstitute nun tun, um Biodiversitätsrisiken zu berücksichtigen und zu einem Teil der Lösung dieser globalen Herausforderungen zu werden? Es gibt bereits Rahmenwerke, um naturbezogene Risiken und Chancen in die Strategie- und Risikoprozesse zu integrieren und eine informierte Entscheidungsfindung zu unterstützen. Ein konkretes Vorgehen unter Mitwirkung unseres Consileon-Expertenteams, orientiert am LEAP-Ansatz (Localize, Evaluate, Assess, Prepare) der TNFD3 (Task Force on Nature-related Financial Disclosure), kann dabei folgendermaßen aussehen:
Sprechen Sie uns an, wenn Sie mehr über den Themenkomplex Biodiversität erfahren möchten. Gerne unterstützen wir Sie dabei, die Biodiversitätsrisiken und -chancen in Ihrem Portfolio zu erkennen und einen Maßnahmenplan zu entwickeln.